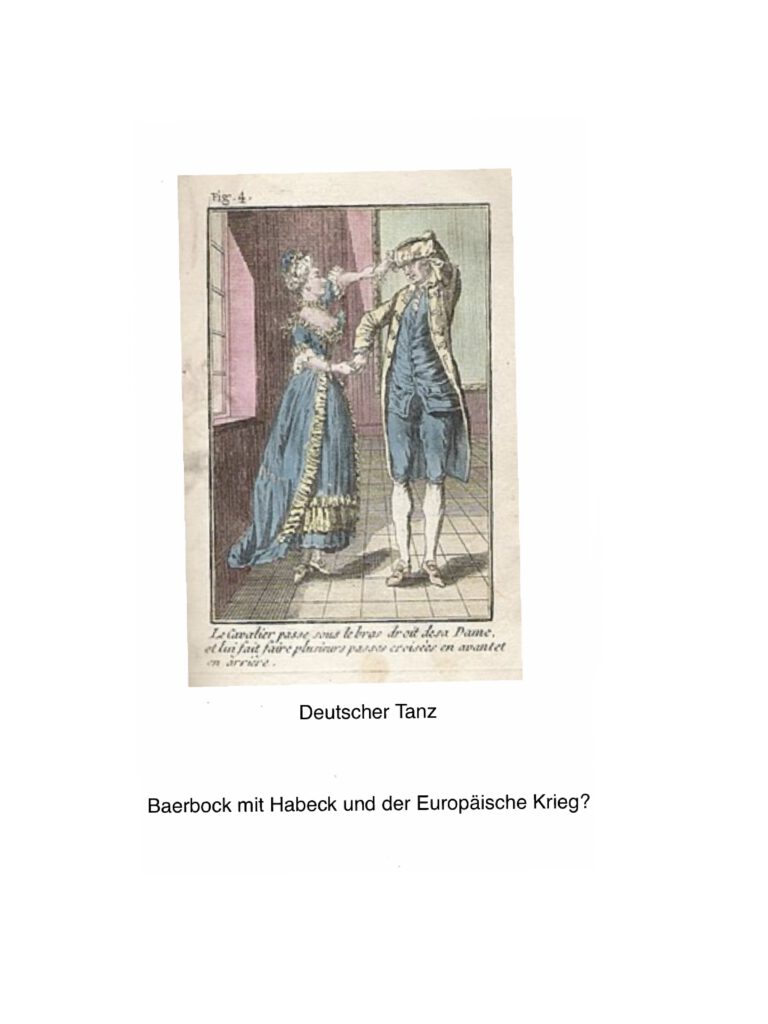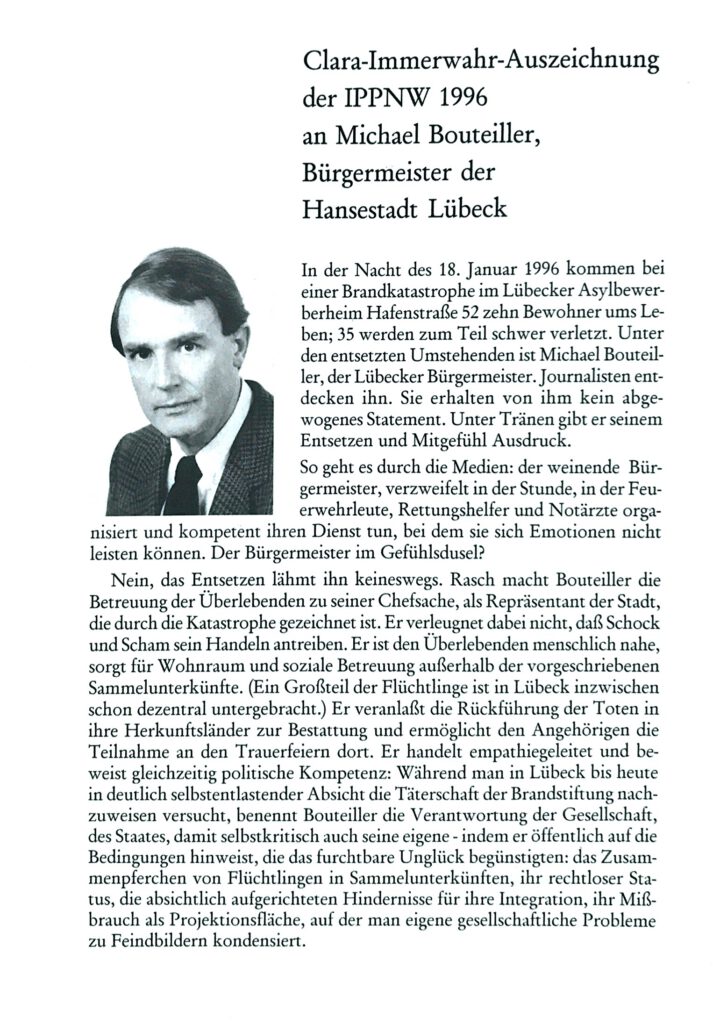
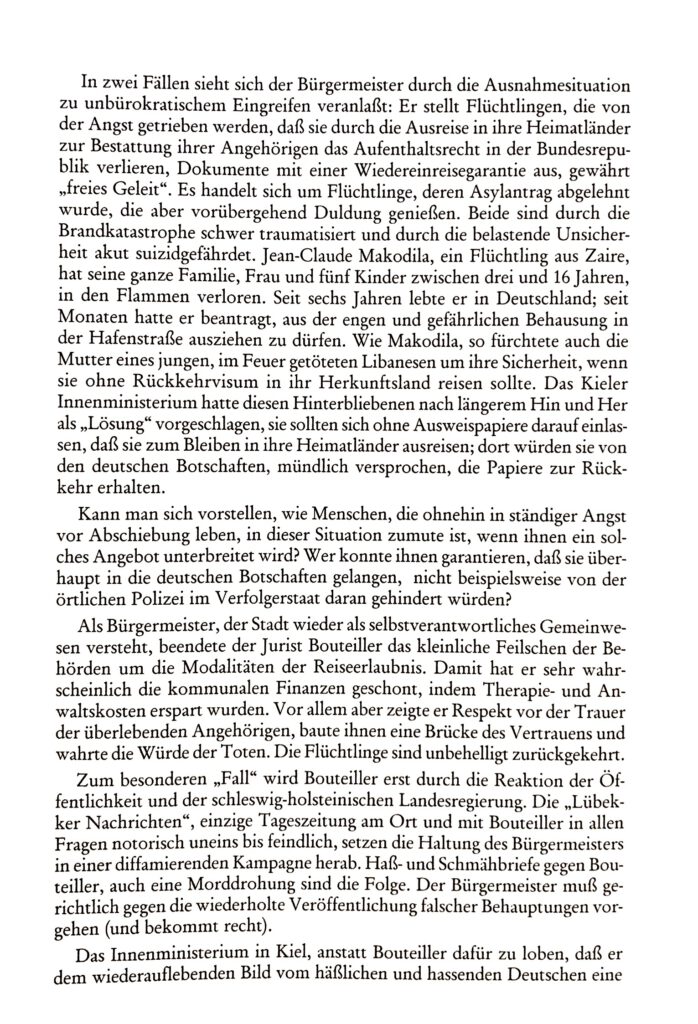
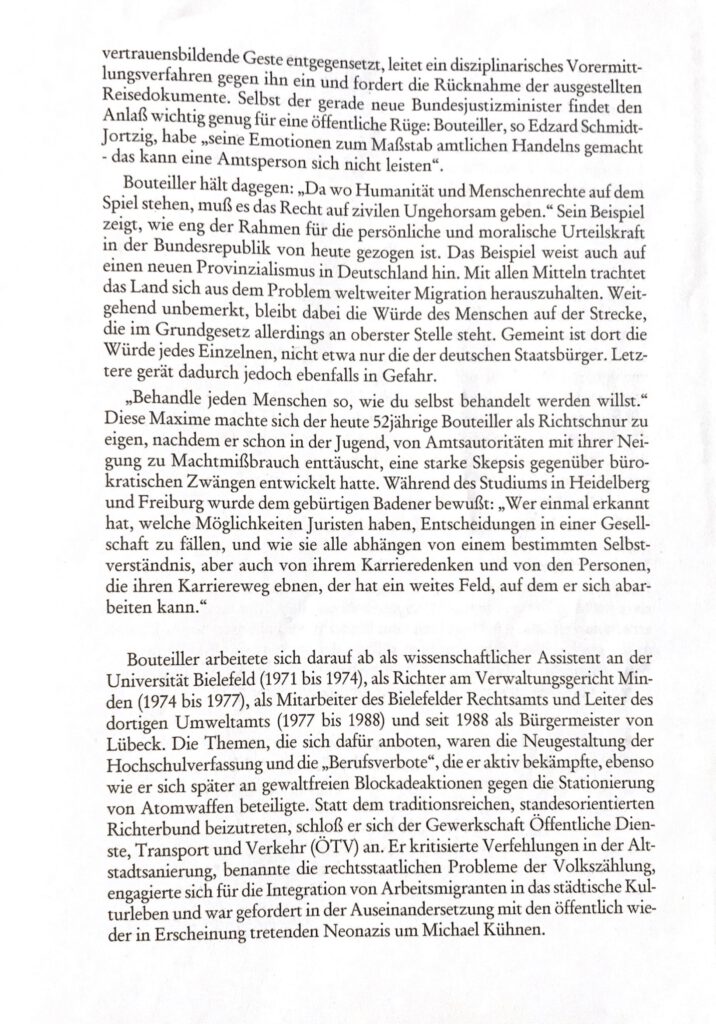
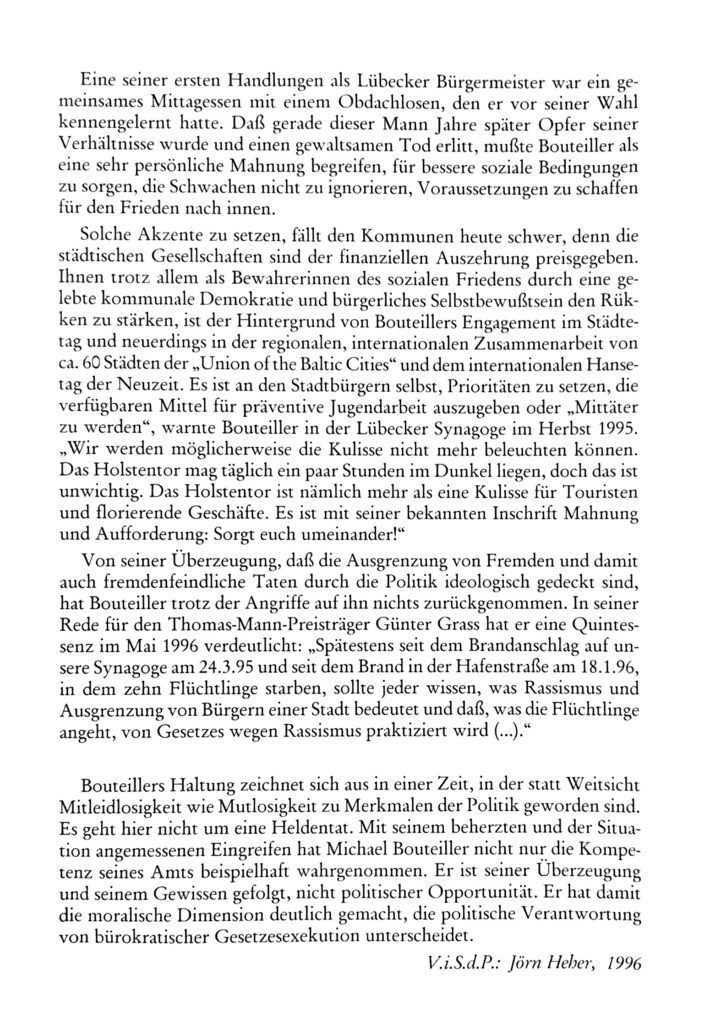
[contact-form][contact-field label=“Name“ type=“name“ required=“true“ /][contact-field label=“E-Mail“ type=“email“ required=“true“ /][contact-field label=“Website“ type=“url“ /][contact-field label=“Nachricht“ type=“textarea“ /][/contact-form]
1943,
Wiss.Assistent Universität Bielefeld,
Richter am Verwaltungsgericht Minden,
Gründung IBZ Friedenshaus (Internationales Begegnungszentrum) Bielefeld,
Aufbau und Leitung Wasserschutzamt Bielefeld,
Bürgermeister a.D. Lübeck,
Rechtsanwalt bis April 2024,
Autor