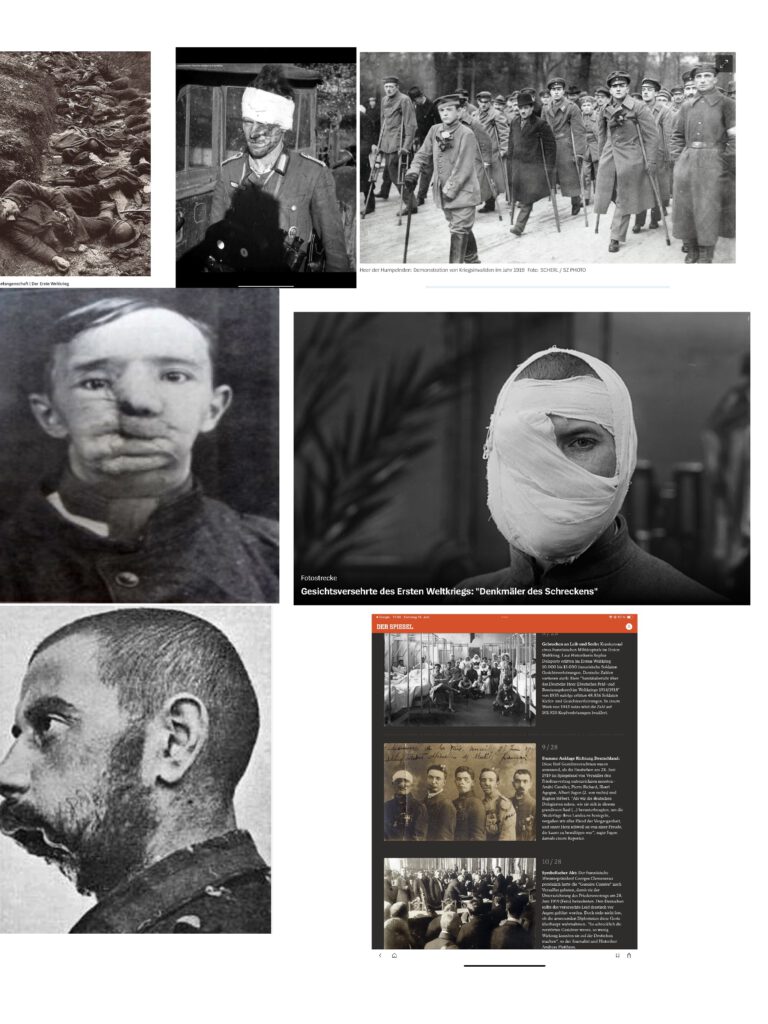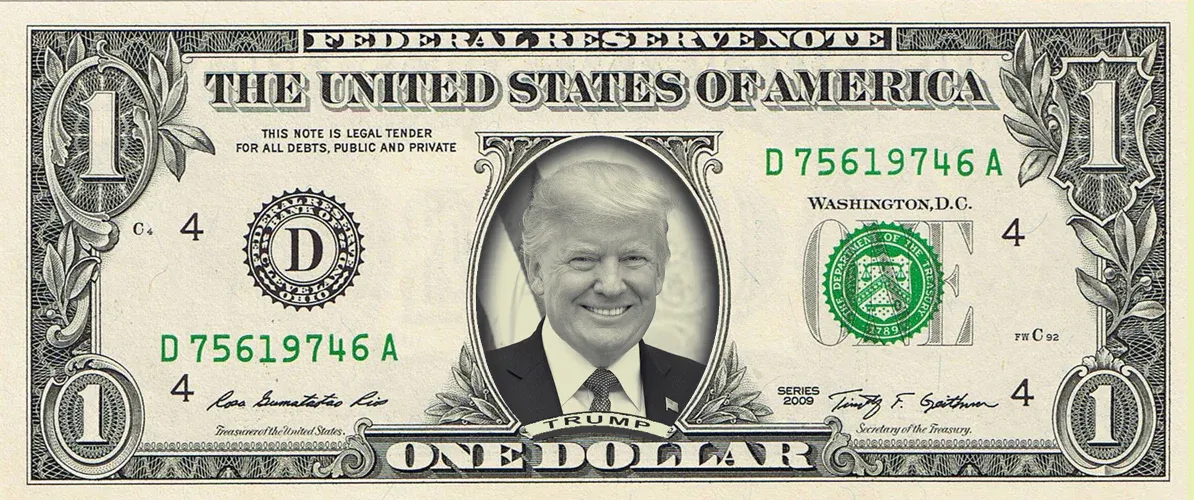
By Umair • 15 Nov 2025
Da ist die amerikanische Börse, die am Rande eines historischen Crashs taumelt. Und da ist Trump, der nun verzweifelt alles tut, um das zu verhindern. Er unterschreibt „Handelsabkommen“ im Eiltempo, als hätte Amerika nicht bereits funktionierende Handelsbeziehungen mit Ländern wie der Schweiz. Plötzlich beschließt er, Zölle auf Grundnahrungsmittel wie Kaffee und Lebensmittel zu senken – Zölle, die der „autokratische Idiot“ selbst verhängt hat. Er verspricht den Leuten eine „Tarif-Dividende“, LOL, was in etwa so ist, als würde ein Taschendieb sagen: Hey, ich bin heute großzügig, hier, nimm einen Teil des Geldes zurück, das ich gestohlen habe.
Verknüpfe die Punkte, was gerade passiert. Hier fährt ein Güterzug unaufhaltsam auf die Katastrophe zu – und derjenige, der die Notbremsen gelöst hat, zieht jetzt am anderen Ende. Es wird wohl nicht funktionieren.
Tag für Tag ist die Börse von Nervosität geplagt. Genau diese Nervosität ist typisch für den Vorabend großer Crashs. Es ist kein Geheimnis, dass wir in einer Mega-Blase leben. Ich habe das hier oft diskutiert, und diejenigen, die Sessions mit mir gemacht haben, sollten ein detailliertes Verständnis dafür haben.
Jetzt erleben wir die „auf den letzten Dämpfen“ Phase einer Blase. Das heißt, einige verkaufen panisch, andere kaufen panisch. Sie „kaufen das Tief“, weil Amerikaner darauf konditioniert wurden. Die Börse kann schließlich nur steigen, richtig? Falsch. Blasen platzen so: Tag für Tag werden die Käufer des Tiefs weniger, Nervosität greift um sich. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem nur noch Verkäufer übrigbleiben.
Jetzt. Lass mich das in den Kontext setzen.
Im letzten Jahrzehnt oder den letzten zwei Jahrzehnten wurden in Amerika heroische Anstrengungen unternommen, damit die Börse nicht fällt. Jedenfalls nicht gesund oder nachhaltig. Sicher gab es Momente, in denen die Märkte kurz eingebrochen sind – wie zu Beginn der Pandemie, oder in der Finanzkrise davor. Aber danach haben die Regierung und die Zentralbank eingegriffen, mit dem ausdrücklichen Ziel, den Markt zu stützen.
Und das hat einen Grund. Amerika ist die letzte hyperkapitalistische Gesellschaft der Welt, oder zumindest war es das – denn unter Trump stirbt sogar der Kapitalismus einen schnellen Tod, und die Wirtschaft wird zunehmend autoritär. Der Grund, warum die Börse in der jüngeren amerikanischen Geschichte nicht fallen durfte, ist ganz einfach: Sie ist das einzige Sicherheitsnetz in der Gesellschaft.
Es gibt zwar Ansätze anderer Netze, aber anders als in anderen reichen Staaten ist Amerika berüchtigt dafür, keine echten, flächendeckenden sozialen Sicherheitsnetze zu haben. In Europa und Kanada genießen die Menschen selbstverständlich moderne Rechte und einen breiten Sozialvertrag. In Amerika gilt: Verlierst du deinen Job, verlierst du die Krankenversicherung, dein Erspartes, dein Haus – bist auf der Straße, stirbst. Es kann jedem passieren, in einem Wimpernschlag, auch denen, die dachten „mir passiert das nie“ – denn sie waren einem kapitalistischen Trugschluss aufgesessen, der ihnen einredet, dass niemand universelle Rechte verdient.
In einer kapitalistischen Gesellschaft wie Amerika gibt es also nur ein echtes Sicherheitsnetz: die Börse. Natürlich nicht im sozialdemokratischen Sinne, universell, gerecht, verlässlich – es ist einfach Kapitalismus. Verfügbar nur für Menschen mit einem gewissen Wohlstand. Aber das ist entscheidend: In Amerika ist das Vermögen der Nation in der Börse gefangen. Man kann dem kaum entgehen: Wer arbeitet, dessen Geld landet letztlich an der Börse.
Und so hängt das Leben davon ab: vom Lebensabend, der Altersvorsorge, der Ausbildung der Kinder. Die Börse übernimmt die Rolle, die in anderen Ländern echte Sicherheitsnetze spielen. In Frankreich ist die Sorbonne kostenlos. In Amerika legt man einen College-Fonds an und hofft auf Hausse – und muss tief durchatmen, denn das Studium kann 100.000 Dollar pro Jahr kosten. Die Börse ist das (dysfunktionale, unvollständige, löchrige) Äquivalent des sozialen Netzes anderer Länder.
Deshalb darf die Börse nicht fallen. Und darin sind sich Republikaner und Demokraten einig. In diesem Sinne sind Amerikaner Gefangene des Kapitalismus, politisch, finanziell, ökonomisch. Das einzige Ziel der politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Institutionen ist: Die Börse muss steigen, um jeden Preis – selbst auf Kosten der Demokratie, des Planeten, der Vernunft, wenn Kinder an Technik süchtig werden, egal, Hauptsache, die Börse ist das letzte Netz – und deshalb wird sie nie fallen gelassen.
Doch jetzt stehen wir vor einer ganz anderen Situation.
Trump hat Amerika auf einen wirtschaftlichen Selbstmordkurs gebracht. Ich weiß, der Durchschnittsamerikaner „glaubt das nicht“, aber das spielt keine Rolle – „Widerspruch“ ist ungefähr so, als würdest du mit dem Arzt über die Krebsdiagnose diskutieren. Das ist keine Debatte.
Unter der Oberfläche der Börsenblase hat sich die US-Wirtschaft verschlechtert. Das Vertrauen ist auf historischen Tiefstständen. Die Preise sind absurd hoch im internationalen Vergleich; das lässt sich besser an der Kaufkraft messen als an den bloßen Inflationsraten. Der Arbeitsmarkt ist desaströs, viele Karrierewege sind fraglich. Erschreckende 70%, 80% der Amerikaner kämpfen finanziell, um ihre Rechnungen zu bezahlen.
Trump hat etwas Monströses entfesselt. Aber das Börsen-Gesicht – alles okay! Schaut weg vom faschistischen Absturz und dem Raubtier-Kapitalismus, der das Leben ruiniert! – ist nur billig aufgesetzt. Es schmilzt in der Mittagshitze, sprich in der Überhitzung der Börse.
Schon jetzt stellen sich die Leute fast die richtigen Fragen.
Die richtigen Fragen lauten nicht: Haben wir zu viel in KI und andere infantile technofeudale Fantasien investiert? LOL, das ist offensichtlich. Brauchen wir wirklich Chatbots, um die Zivilisation zu retten? Auf einer brennenden Erde? Das ist die Kurzsichtigkeit des Kapitalismus, der die Leute, ganz ehrlich, einfach dumm macht. Sie stellen nicht die richtigen Fragen. Gier macht blind, Eitelkeit macht dumm. Die richtige Frage jetzt ist: Worauf haben wir zu wenig gesetzt? Und die Antwort lautet: Auf alles, was zählt.
Menschen, Leben, Zukunft, Planet, Demokratie, Zivilisation – all das. Klimaschutz, Bildung der Kinder, Forschung an dem, was wir wirklich benötigen, wie Grundstoffe von Dünger bis Zement, die nicht auf fossilen Brennstoffen basieren; Finanzsysteme, die nicht nur räuberisch sind; Sozialverträge mit Bestand; Kultur, die uns geistig und seelisch nicht vergiftet; eine Gesellschaft, in der wir Beziehungen, Intellekt und lebendige Leben führen können, nicht nur Ungleichheit, Gier und Verzweiflung.
Wenn die Fassade im Crash schmilzt, nach einer der größten Blasen der Geschichte, werden solche Fragen endlich gestellt. In Amerika kommt das Verständnis zu spät: Man hat sich nicht genug um die Zukunft gekümmert, um überhaupt eine zu haben. Und in diesem Kontext wird Trumps „Wirtschaftspolitik“ – und solche Begriffe sind blanker Hohn – als die suizidale Ideologie erkennbar, die sie ist.
Das ist der Todeskampf. Außer du denkst, deine Enkel sollen KI auf einer brutzelnden Erde essen. Oder du glaubst, Turbo-Faschismus ist gut für Menschheit und Wohlstand.
Das Schlimmste steht Amerika noch bevor. Denn jetzt gibt es keine Zukunft mehr, da niemand mehr eine will oder an sie denkt. Selbst in den kalten, psychopathischen Begriffen des Kapitalismus braucht es mehr als diese toxische Mischung, um langfristig Börsenrenditen zu erzielen – eine Blase in KI & Krypto auf der einen und Autokraten, die die Institutionen und den Wohlstand plündern auf der anderen Seite. Sogar der Kapitalismus kann so keinen Wohlstand generieren.
Hörst du den letzten Todesstoß?
Das letzte Sicherheitsnetz der USA, die Börse, steht vor einer düsteren Zukunft, genauso wie der Rest. Das ist ein subtiler Punkt: Es gibt eine Welt, in der die Börse „unendlich steigt“, aber nur mit immer heftigerer Volatilität – mit mehr Blasen und Crashs, und solche Märkte sind langfristig schlechte Investments.
Und dann gibt es eine Welt, in der die amerikanische Wirtschaft, durch Trump von Kapitalismus zu Autokratie zurückgeworfen, bergab geht und die Börse samt Lebensstandard jahrzehntelang sinkt.
Welche Welt wird es? Dass die Börse immer weiter steigt, glaube ich nach all den Kosten fürs Stützen nicht mehr. Eher wird die Zukunft von immer größerer Volatilität und längeren Abwärtstrends geprägt sein. Klartext: Amerikas einziges Sicherheitsnetz steht vor dem Zusammenbruch. Und wenn das passiert, wird es kritisch.
Denn ohne dieses Netz werden die Amerikaner auf die harte Tour lernen, was die Wahl für Trump und gegen die Demokratie bedeutet.
Wie sollen Amerikaner in einer Wirtschaft leben, in der die Börse nicht mehr als Sicherheitsnetz funktioniert? Wie sollen sie in Rente gehen, die Kinder ausbilden, Hauskredite abbezahlen? Die Antwort lautet: Sie werden es nicht können.
Das ist, was der Todesstoß besagt. Das Leben in Amerika wird in einem Ausmaß düster, wie man es sich kaum vorstellen kann – für Amerikaner selbst und für den Rest der Welt. Werden ältere Menschen einfach ihrem Schicksal überlassen? Kranke einfach ignoriert? Werden Millionen weiter am Abgrund leben? Und das soll gut für Wirtschaft und Börse sein? Frag die Große Depression.
Kein schönes Bild. Aber genau deshalb versucht Trump jetzt, den Börsencrash zu verhindern. Denn er weiß, dass davon auch sein politisches Schicksal abhängt – ein Stück weit jedenfalls. Es ist das Letzte, das der amerikanischen Gesellschaft wirklich noch etwas bedeutet. Das Einzige, sage ich oft. Weil sie müssen. Es ist alles, was bleibt, denn sie haben keine Demokratie, keine moderne Gesellschaft und keine Zukunft.
Das ist der letzte Todesstoß. Die größere Tragödie ist, dass das Leben überhaupt erst auf diese Gefangenschaft reduziert wurde. Und das ist mehr als nur Moral: Es ist eine fundamentale Lektion darüber, wie Wirtschaft wirklich funktioniert und warum all das zählt. Überlege gut, ob du dein Vermögen diesem Niedergang aussetzen willst.
Wir sind nicht mehr in der alten Welt. In dieser neuen, das Geld den Monstern und dem „Monster auf der Leine“, dem räuberischen Kapitalismus und seinen autokratischen Fantasien hinterherzuwerfen, ist wohl die sicherste Methode, es zu verlieren.
Adam Tooze zum Bubble