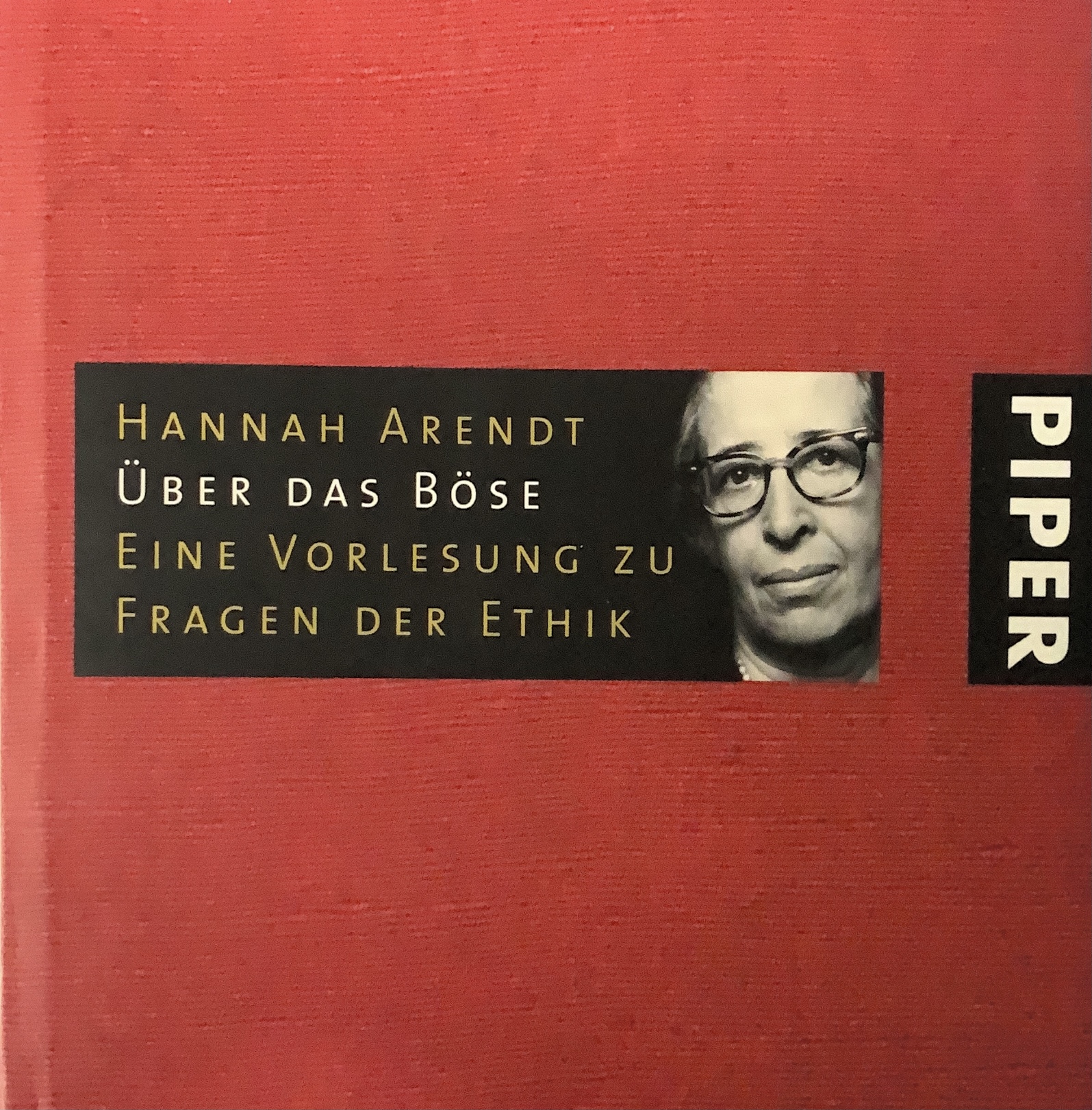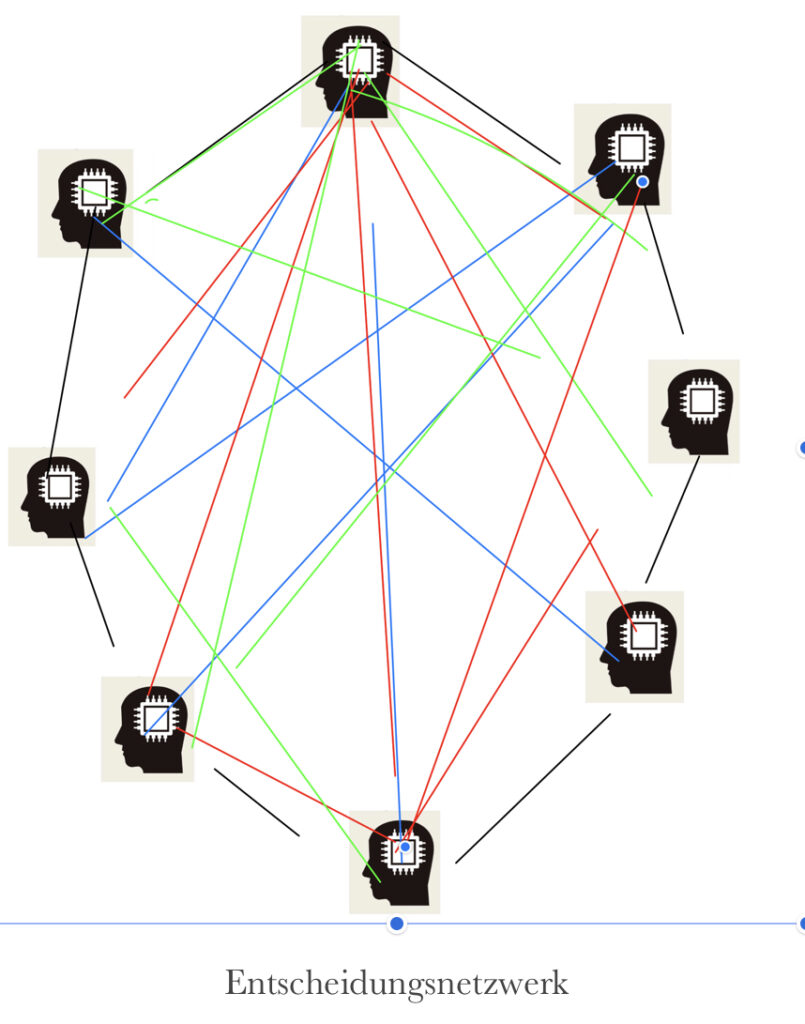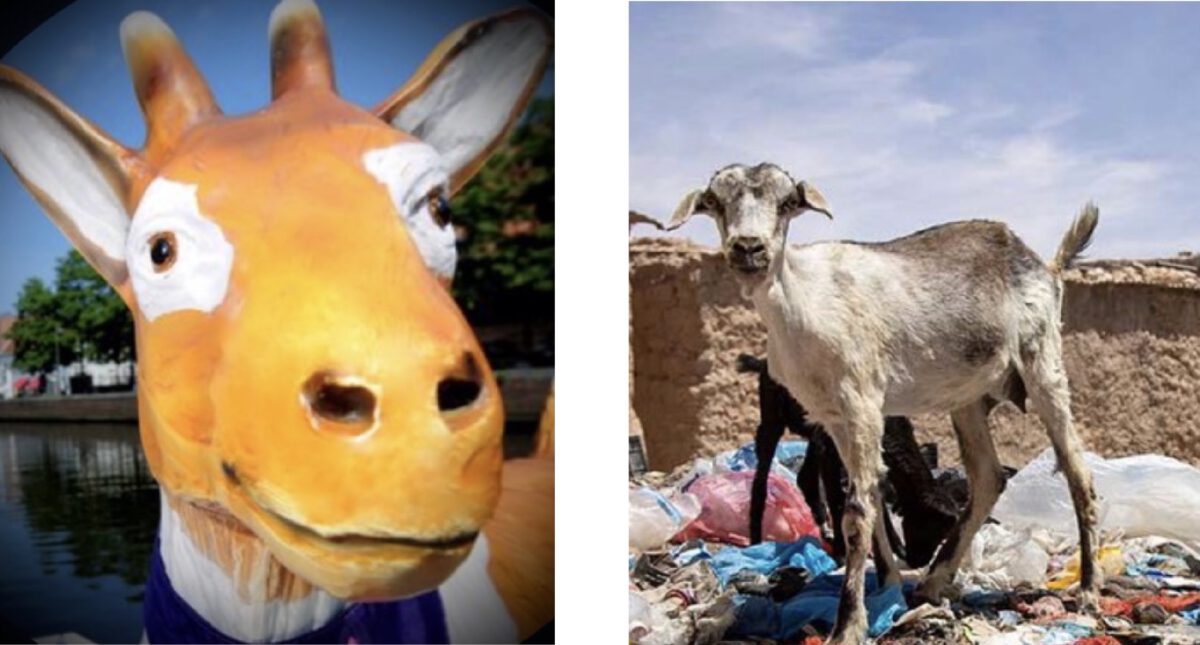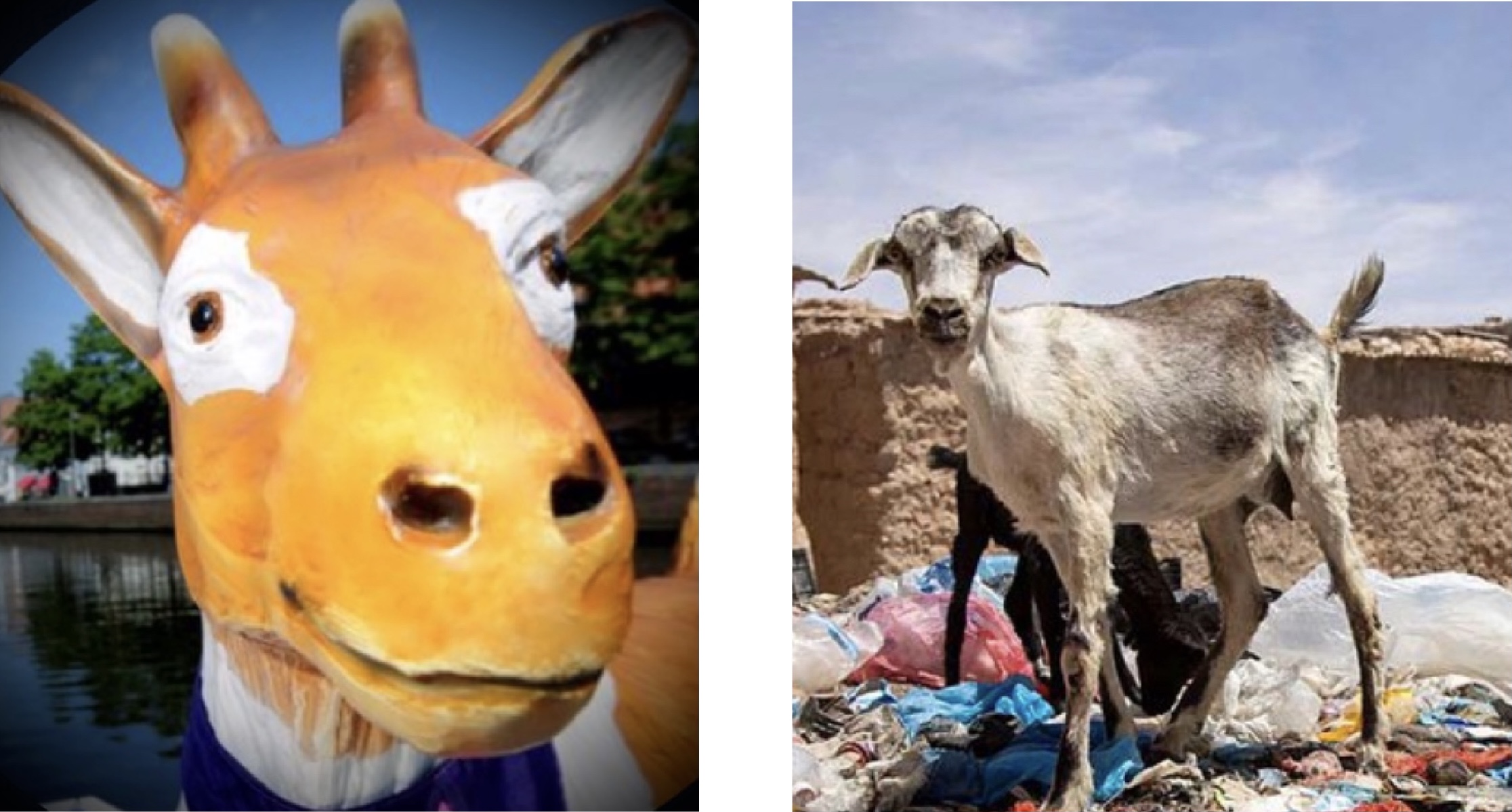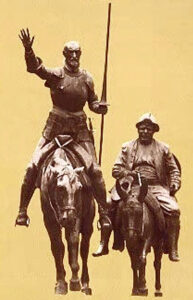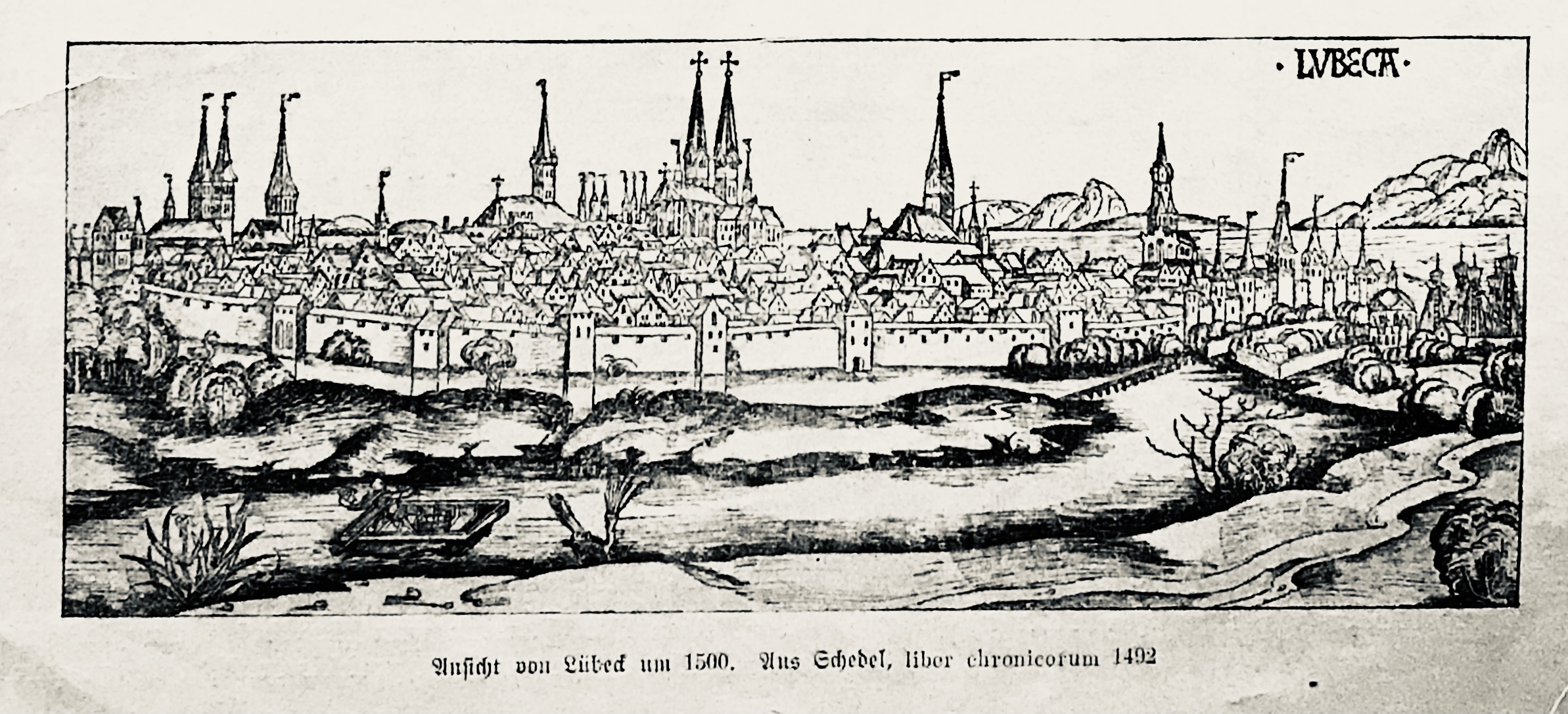Der Abstieg der konservativen Amerikaner in Wahnsinn, Gewalt und Faschismus
Umair Haque 18.2.2021
Hier ist eine kleine Frage. War der 6. Januar Amerikas Tiefpunkt?
Um Ihnen bei der Beantwortung zu helfen, finden Sie hier eine auffällige, ernüchternde und beunruhigende Tatsache. Seit dem Putschversuch am 6. Januar, bei dem Todesschwadronen durch die Hallen des Kongresses streiften, um nach „Feinden des Volkes“ zum Massaker zu suchen, wo würden Sie Trumps Unterstützung unter den Republikanern erwarten?
Wenn Sie den Republikanern den Vorteil von Treu und Glauben geben, würden Sie vielleicht erwarten, dass er sinkt. Immerhin war dies mehr oder weniger eines der beschämendsten und groteskesten Kapitel der amerikanischen Geschichte. Sie müssen Jahrhunderte zurückgehen, um herauszufinden, wann das Kapitol das letzte Mal angegriffen wurde – und von faschistischen Milizen angegriffen wurde? Angeblich von einem Präsidenten angestiftet? Das ist nie passiert. Der 6. Januar war ein einzigartiger Moment in der amerikanischen Geschichte.
Und Sie könnten daher vernünftigerweise erwarten, dass es einen Tiefpunkt erreicht, und Sie könnten daraus weiter schließen, indem Sie sich denken: „Selbst Republikaner müssen denken, dass dies zu weit gegangen ist. Richtig?“
Falsch. Seit dem 6. Januar hat Trumps Unterstützung unter den Republikanern zugenommen . Dramatisch. Und das ist ein schlechtes Omen für die kommenden Dinge. Welche Art von Menschen unterstützen schließlich einen gewalttätigen, blutigen Staatsstreich? Es stellte sich heraus, dass die Arten von Menschen mit Konzentrationslagern, Kindern in Käfigen und Gestapos auf den Straßen einverstanden waren – die gesamte klassische Lehrbuchsequenz des Faschismus. Wenn Sie mit… Konzentrationslagern… einverstanden sind, ist es keine Überraschung, dass Sie mit einem Coup einverstanden sind. Es ist alles Teil Ihrer… Weltanschaaung. Das ist ein altes deutsches Wort für eine einfache Idee: eine Weltanschauung .
Was passiert mit Amerika?
Das konservative Amerika wird radikalisiert. Du weißt es und ich weiß es. Experten wissen es und meistens erfinden sie Ausreden dafür. Die Wahrheit ist jedoch ebenso düster wie schrecklich. Das konservative Amerika wird schnell, streng und massiv radikalisiert.
Als soziale Gruppe vertreten konservative Amerikaner heute Überzeugungen, die eher den Taliban entsprechen als beispielsweise ihren Kollegen in Europa, Kanada oder Australien. Nein, ich mache keine Witze. Konservative Amerikaner scheinen zu glauben, dass alle folgenden Dinge Menschenrechte sein sollten: ein Sturmgewehr nach Starbucks tragen, so viele Waffen haben, wie Sie möchten, die „Redefreiheit“ haben, um Bigotterie und Hass zu praktizieren, die Idee der weißen Vorherrschaft, eingebettet in Institutionen und gesetzlich durchgesetzt, die Auferlegung der fundamentalistischen Religion über den Staat.
Folgendes glauben sie nicht, sollten grundlegende Menschenrechte sein. Gesundheitswesen, Bildung, Ruhestand, Kinderbetreuung, Transport, Einkommen, Wohnen, Essen, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Medizin.
Ich möchte, dass Sie wirklich sehen, wie pervers diese Ansichten sind. Sie sind das diametrale Gegenteil der Mehrheiten in jedem anderen reichen Land. In Europa, Kanada und Australien glauben die Menschen im Großen und Ganzen, dass Gesundheitsversorgung, Ruhestand und Bildung usw. grundlegende Menschenrechte sein sollten, nicht Waffen, Hass und Fundamentalismus. Wir wissen das, weil sie insgesamt für sie stimmen . Dies ist das Gegenteil von Amerikas konservativer Mehrheit.
Daher mache ich keine Witze, wenn ich sage, dass amerikanische Konservative den Taliban mehr ähneln als „Konservativen“ in Europa, Kanada oder Australien. Amerikanischen Konservativen wirklich sind anders. Wer glaubt noch, dass Sturmgewehre ein Menschenrecht sind? Diese Religion sollte das Gesetz diktieren? Dass Hass und Vorherrschaft kulturelle Normen, soziale Werte und politische Institutionen sein sollten? Die Taliban tun es .
Auch dies ist kein Witz. Es ist eine Warnung . Das konservative Amerika, das ein Großteil des weißen Amerikas ist, wird radikalisiert .
Sie könnten mit den Schultern zucken und sagen: „Na und! Das weiß ich schon!“ Aber irgendwie bezweifle ich, dass du es wirklich tust. Diejenigen von uns, die die schreckliche, desorientierende Erfahrung einer Gesellschaft erlebt haben, die um uns herum radikalisiert wird, können Ihnen sagen: Was in Amerika passiert, ist die Realität . Wenn es sich für Sie so anfühlt, als hätte ein großer Teil Amerikas gerade den Verstand verloren, dann liegt das daran, dass… es so ist.
Was bedeutet „Radikalisierung“?
Es geht weit über das hinaus, was sich viele Amerikaner vorstellen. Es bedeutet so etwas wie das Folgende. Über einen Zeitraum von Jahren, vielleicht Jahrzehnten, werden Menschen konditioniert und einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass a) Gewalt die Antwort auf alle politischen Probleme ist; b) Hass ist die Antwort auf alle sozialen Probleme; c) Bigotterie ist die Antwort auf alle kulturellen Probleme; weil d) die Starken und Reinen überleben müssen, indem sie die Schwachen und Unreinen überwältigen; so dass d) ein magisches, oft religiös gesalbtes Königreich auf Erden herrscht.
Radikalisierung ist ein seltsamer, giftiger Cocktail aus vielen, vielen Dingen – all den Aromen menschlicher Dummheit und Torheit. Es verbindet den Sozialdarwinismus mit einer Nietzscheanischen Übermensch-Ideologie. Es predigt fundamentalistische Religion und vergisst dabei die Grundprinzipien jeder Religion. Es rechtfertigt sich mit zunehmend ausgefallenen „Theorien“, die im Klartext nur Big Lies bedeuten – der Messias kommt und so weiter -, deren Ziel es ist, die Auserwählten in Ritualen der sinnlosen Indoktrination zusammenzubinden. Es geht offen um Gewalt und Brutalität mittelalterlicher Art. Es sucht jetzt hier auf der Erde nach einer Apokalypse, denn das ist der beste Weg, das Reine vom Unreinen zu trennen – eine endgültige Lösung.
Klingt das alles für Sie nach amerikanischem Konservatismus? Es sollte . Ich sollte es nicht noch einmal sagen müssen, aber ich werde es tun: Amerikanische Konservative scheinen jetzt die Art von Menschen zu sein, die solche Dinge glauben – braune Kinder in Konzentrationslager zu bringen ist eine gute Sache, weil es Trump dient und Trump Gott dient und Amerika ist Gottes verheißenes Land für die Reinen.
Nichts davon hat sich geändert. Sie glauben immer noch das alles. Sie scheinen den Grundsätzen wirklich radikalisierter Glaubenssysteme auf immer härtere und extremere Weise zu glauben . Nehmen wir die Idee, die sich unter evangelischen Christen verbreitet, dass Trump eine Art religiöser Held ist . Nehmen Sie QAnon, der besagt – wenn Sie es noch nicht wissen -, dass Hillary Clinton die Gesichter der Kinder filetiert hat , um ihr adrenalisiertes Blut zu ernten und zu trinken, um für immer jung zu bleiben.
Der einfachste Weg, den radikalen Verstand zu verstehen, ist jedoch eine sehr einfache Frage. Was ist der Rest von uns für die Radikalisierten? Die Antwort auf diese Frage ist normalerweise so einfach wie aufschlussreich. Nimm einen radikalisierten Muslim. Was ist der Rest von uns? Ungläubige. Wohin gehen wir? Hölle. Was verdienen wir hier auf Erden? Nichts . Außer vielleicht Leiden, Schmerz und Hass.
Stellen wir nun die Frage für amerikanische Konservative. Was ist der Rest von uns für sie? Mit dem Rest von uns meine ich uns alle . Und hier wird es wirklich hässlich, sehr schnell. Sie scheinen zu denken, dass Minderheiten rassisch unterlegen sind, was bedeutet, dass sie genetisch, mental, kulturell und sozial unterlegen sind. Die LGBTsind Heiden, gottlose Menschen, was natürlich auch Minderheiten sind. Liberale sind „Feinde des Volkes“, wie jeder auf „ihrer Seite“, von Journalisten über Intellektuelle bis hin zu Politikern. Aber Oppositionspolitiker sind die schlimmsten von allen. Sie sind Verräter, die „die Wahlen gestohlen haben“, und sie verdienen jede Strafe, die ihnen bevorsteht, auch wenn es sich um einen Staatsstreich handelt, dessen Ziel es zu sein schien, sie zu massakrieren.
Denken Sie an all das. Was sagt es, dass die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Konservativen den Putsch unterstützt hat? Dass Trumps Unterstützung danach stieg ? Zu einer sozialen Gruppe, die bereits mehr mit den Einstellungen der Taliban gemein hat als beispielsweise Weiße in Europa oder Kanada? Es heißt, dass sie schneller radikalisiert werden, als Sie oder ich blinzeln können.
Nehmen Sie noch einmal das Beispiel von QAnon. Wenn ich Ihnen vor ein oder zwei Jahrzehnten gesagt hätte, dass viele der durchschnittlichen amerikanischen Konservativen geglaubt hätten, Hillary führe satanische Rituale durch, bei denen sie Kindergesichter zerschneidet, um ihr adrenalisiertes Blut zu trinken, damit sie für immer jung bleibt… auf die die Juden Weltraumlaser schießen Amerika … dass Liberale Pädophile sind, die Satan verehren … Sie hätten mich wahrscheinlich ausgelacht. Aber jetzt lacht niemand mehr . Wie viele Konservative glauben solche Dinge? Die einzig richtige Antwort darauf lautet: viel zu viele: 56% der Republikaner glauben an einen Teil von QAnon. Mehr als die Hälfte. Denk darüber nach.
Die Grundprinzipien eines radikalisierten Glaubenssystems steigen und verhärten sich unter amerikanischen Konservativen schnell. Die Idee, dass Gewalt etwas zu bewundern ist, weil sie die Schwachen von den Starken trennt. Die Idee, dass eine bestimmte Gruppe von Auserwählten von Gott dazu bestimmt wurde, über die anderen zu herrschen, die minderwertig sind. Das Gefühl, dass sie wegen ihres Adels und Heldentums von unsichtbaren und bösartigen Feinden verfolgt wurden – die in einer endgültigen Lösung beseitigt werden müssen. Die Vorstellung, dass Demokratie selbst etwas zu verachten ist, und die Regel des Religionsrechts und die bloße Brutalität sollten geschätzt werden. Die Rechtfertigung all dessen mit zunehmend bizarren, gruseligen und grotesken Lügen – deren einziger wirklicher Zweck darin besteht, Konservative vor hässlichen Wahrheiten wie zu schützenniemand anderes ist gewalttätig oder gefährlich oder hasserfüllt hier als sie .
Sie könnten sich sagen: „Radikalisierung ist nicht das richtige Wort. War das konservative Amerika nicht immer ziemlich schrecklich? “ Du liegst nicht falsch. Was hier passiert, ist nicht die Entwicklung eines neuen Glaubenssystems, sondern die Umkehrung zu einem alten. Und in diesem Fall überhaupt nicht sehr alt. Bis 1971 (dem Ende der Segregation) war Amerika, wie ich glaube, viel bekannter und verständlicher sein sollte, der größte Apartheidstaat der Welt. Südafrika war vergleichsweise nur ein Ausrutscher.
Das war vor weniger als einem Leben. Und es ist klar, dass sich viele Amerikaner nie über das Glaubenssystem der Zeitalter der Sklaverei und Segregation hinaus entwickelt haben – das Glaubenssystem der Vorherrschaft und des Hasses, gerechtfertigt durch Religion, Ausnahmezustand und Patriotismus. Das konservative Amerika scheint wieder dorthin zurückzukehren, wo es vor 1971 war, vielleicht sogar lange zuvor. Es ist eine soziale Gruppe, in der gerade alles läuft .
Ich mache keine Witze darüber. Wer wählt nach den Konzentrationslagern wieder einen Präsidenten, Gestapos, Kinder in Käfigen, Schläge, Verschwindenlassen, die Lehrbuchsequenz des Faschismus? Konservative Amerikaner. Trumps Anteil an den weißen Wählern Amerikas stieg von 2016 bis 2020.
Viele (nicht alle) Amerikaner auf der linken Seite haben das Gefühl: Jetzt, wo Biden gewonnen hat, ist alles in Ordnung. Aber das ist, wie das Amtsenthebungsverfahren gezeigt hat , sehr, sehr falsch. Warum ist die GOP immer noch Trumps Partei? Warum entschuldigte sich Mitch McConnell mit mehligem Mund für den Freispruch ? Da die GOP hat Trump Partei sein. Republikanische Wähler halten ihre Füße ans Feuer. Weil das konservative Amerika radikalisiert wird, hat die GOP keine andere Wahl, als eine geradezu extremistische Partei zu sein, die jede schlechte Idee in der Geschichte der Menschheit unterstützt, vom Faschismus bis zur Theokratie.
Und das sind sehr schlechte Nachrichten. Weil Fanatiker und Extremisten, die die Demokratie aufgegeben haben, normalerweise nicht mit ihren Werkzeugen kämpfen. Sie greifen auf mehr, na ja, extreme Methoden zurück. Waffen und Bomben. Terror und Einschüchterung. Gewalt und Brutalität. Dummheit und Hass. Eine Welle von allem, was jetzt auf dem Plan steht, einfach weil Millionen von Amerikanern einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um zu glauben, dass all das in Ordnung ist. Ihre Prediger sagen ihnen, dass es so ist. Ihre Journalisten verstärken die Botschaft. Ihre Intellektuellen rechtfertigen es. Ihre Politiker feuern alles an. Wer bleibt übrig, um sie zur Vernunft zu führen? Niemand .
So viele, viele Gesellschaften sind gefallen. So entstanden die Taliban. Auf diese Weise wurde die muslimische Welt zu einer Brutstätte für Verrücktheit und gescheiterte Staaten. So wurde Russland zum Mafia-Staat, wie es heute ist. Es ist die Geschichte der Menschheitsgeschichte, immer und immer wieder.
Verlassen Sie sich nicht auf Demokratie, wenn die andere Seite sie bereits aufgegeben hat. Die zu erledigende Arbeit geht weit über das bloße Verlassen auf Demokratie hinaus, wenn die andere Seite glaubt , dass es das Problem ist und die Lösung eine endgültige ist .
Welche Art von Arbeit ist das? Es geht um Wirtschaft, Kultur, Soziales und darum, Normen, Werte, Codes, Ideen in jedem Lebensbereich und in jedem Aspekt der Gesellschaft zu ändern. Und dann, langsam, vielleicht, nur vielleicht, ändern sich auch die Gedanken .
Und als jemand, der zuvor Radikalisierung gelebt hat, weiß ich so viel. Wenn es nicht gestoppt wird, mit einer Grundwelle, schnell und sicher, überwältigt es ein Land – Schnappschuss !! – so wie das. Ich denke, dass gute Amerikaner im Moment ihre Selbstgefälligkeit und Apathie an der Tür überprüfen müssen – nein, Biden wird nicht auf magische Weise alles reparieren – und ernsthaft verstehen müssen, wie viel Ärger ihr Land wirklich hat. Denn die Antwort lautet: viel , viel mehr, als sie noch wirklich vollständig zu erfassen scheinen.
Umair
Februar 2021