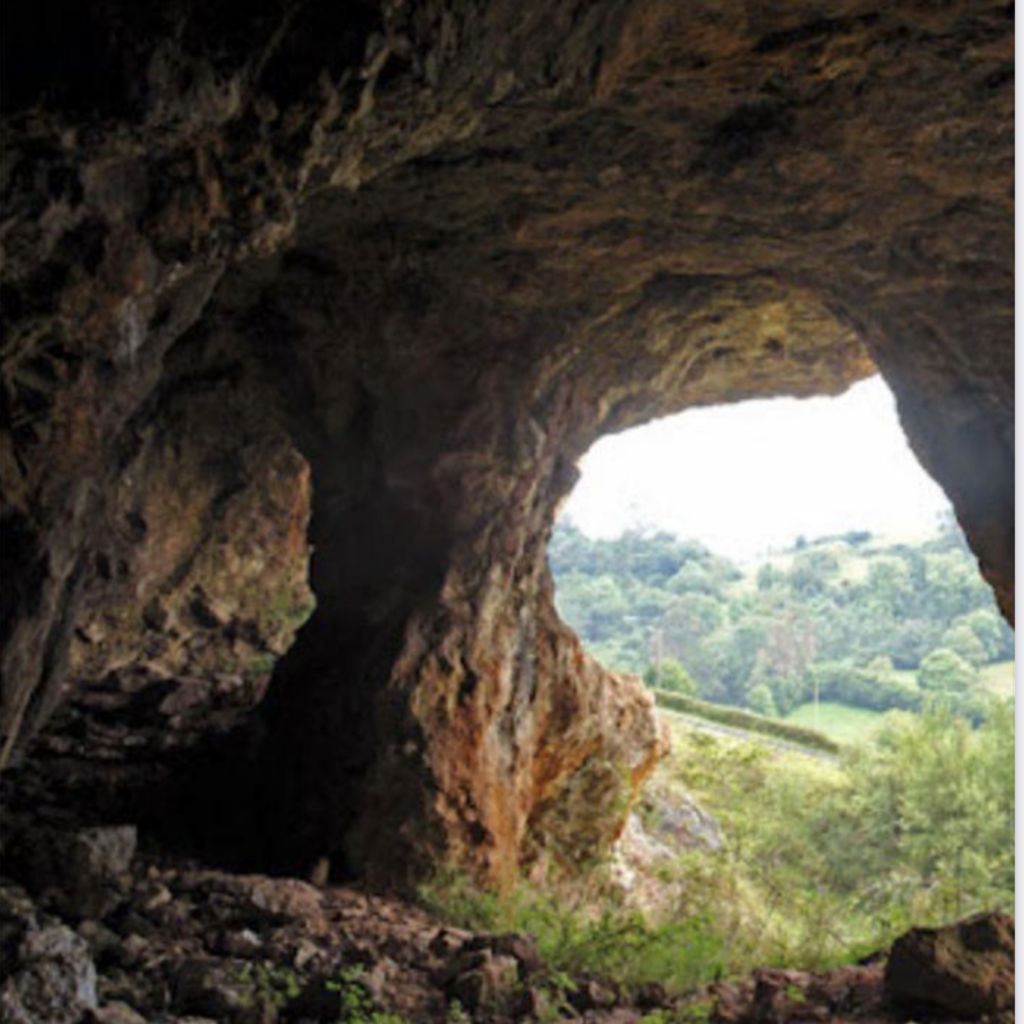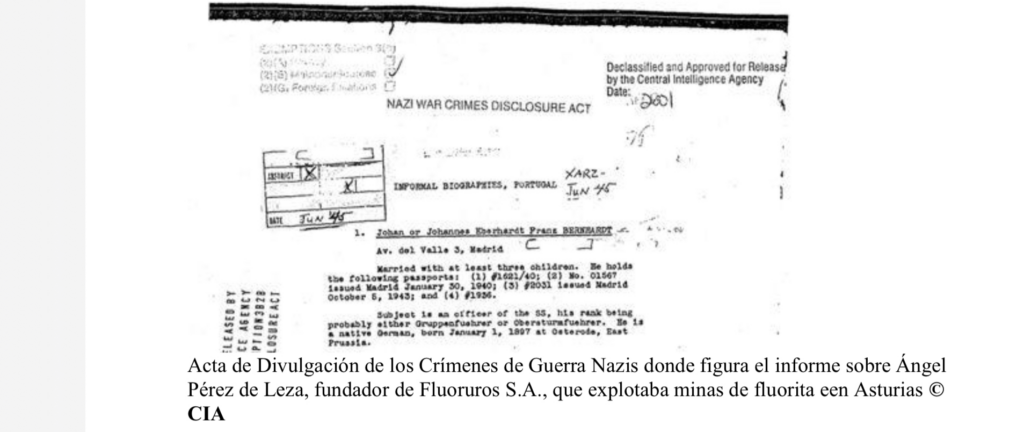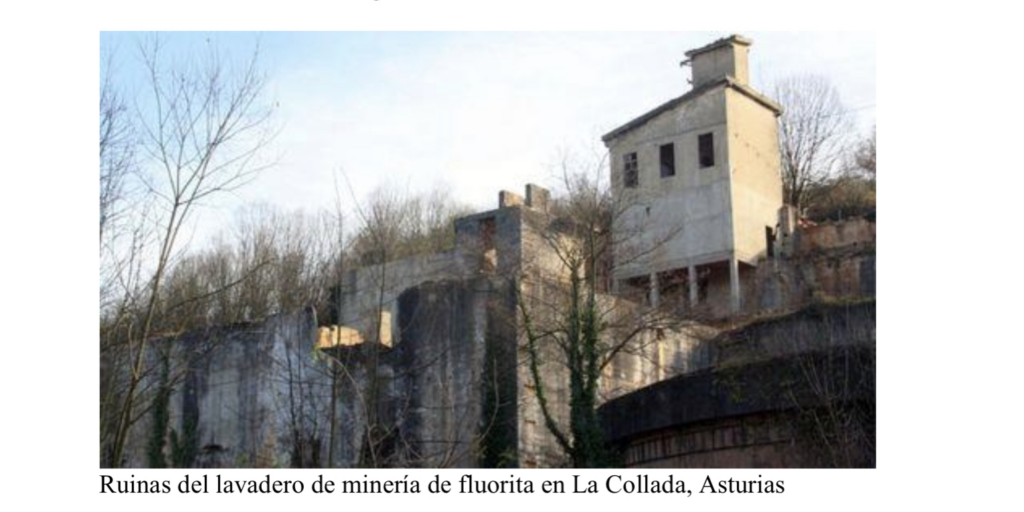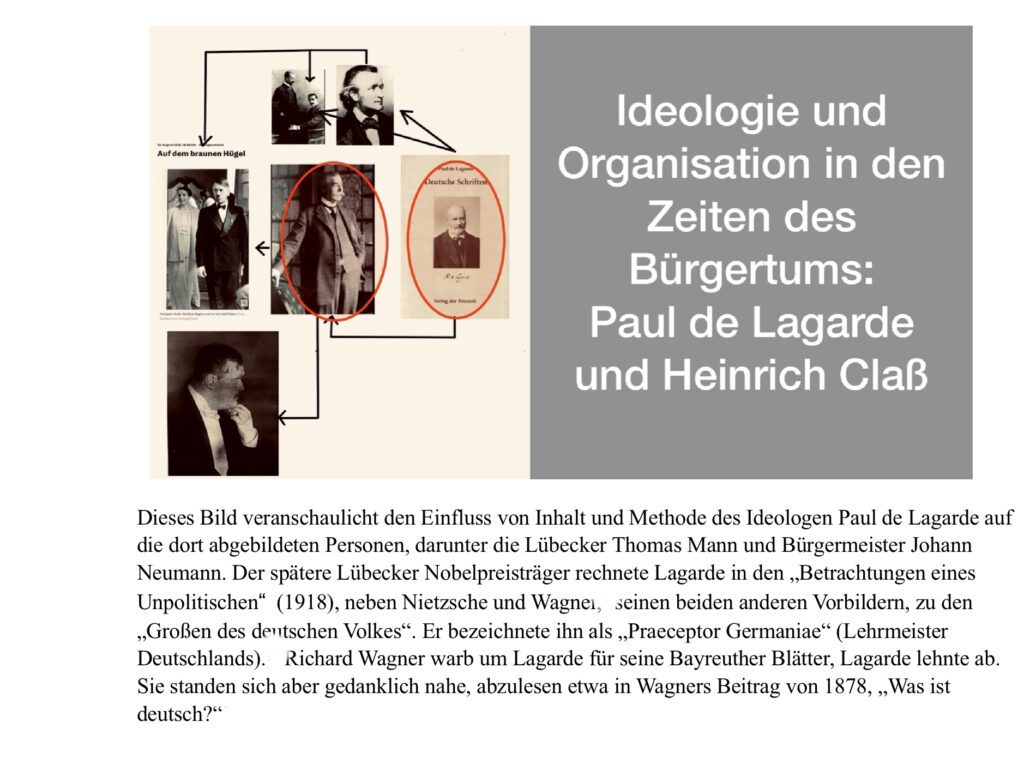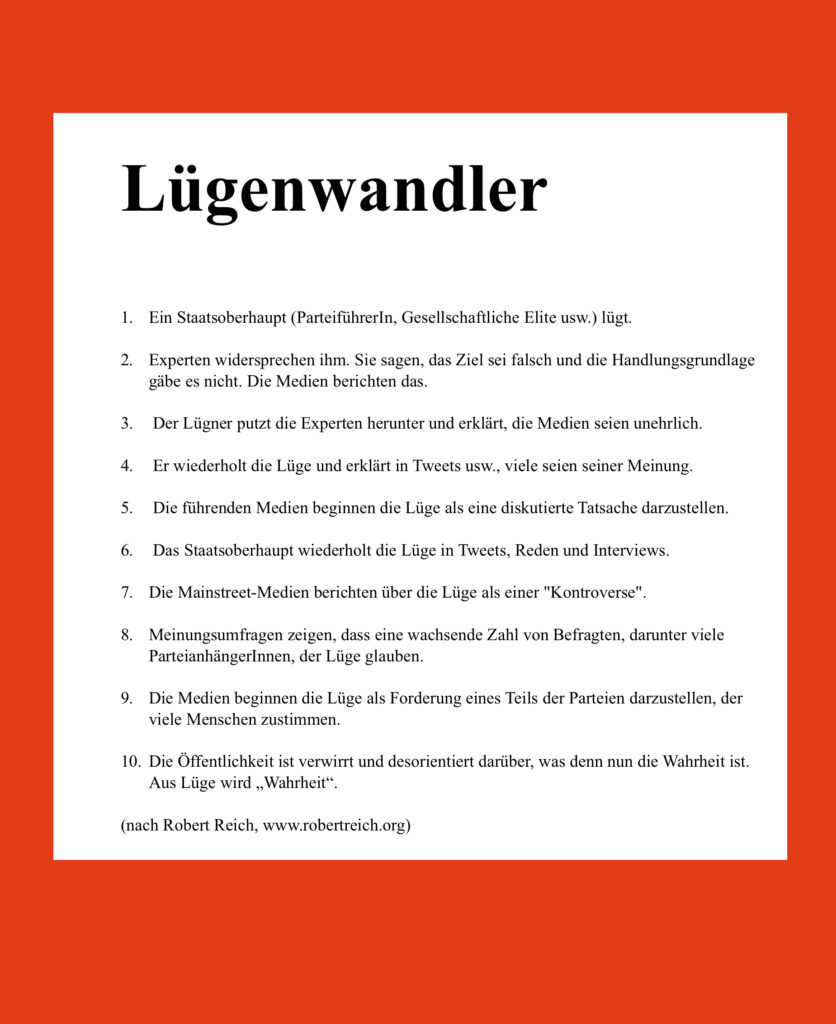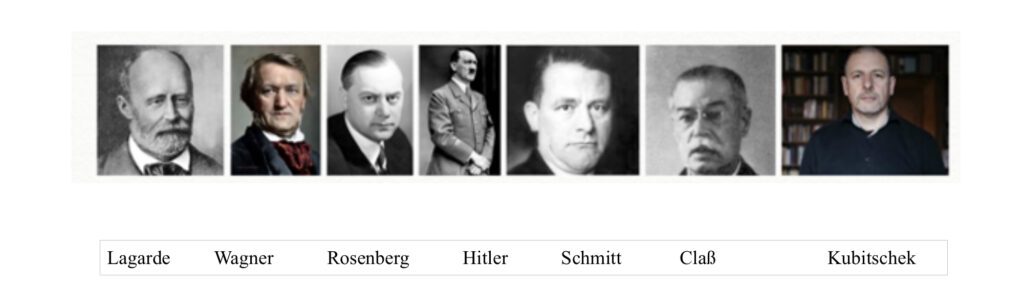Freitag, 18. August 2023, FR Deutschland / Wirtschaft
von Tagesstätten, fehlendem Personal und unversorgten Kindern
Über Jahrzehnte hat die Bremer Kita-Expertin Ilse Wehrmann in der Frühpädagogik gearbeitet. Doch nie sei die Situation in diesem Arbeitsbereich so schwierig gewesen wie jetzt, sagt die 73-jährige.
Frau Wehrmann, wie geht es den Kitas in Deutschland?
Desaströs. Es fehlen jede Menge Fachkräfte, es fehlen jede Menge Plätze. Was ich beanstande: Das ist kein Überraschungseffekt. Den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gibt es seit 1996 und seit 2013 den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren. Wir schreiben Rechtsansprüche auf und realisieren sie aber nicht, da passiert im Grunde an jedem Tag ein neuer Rechtsbruch. In Bremen fehlen 5000 Kitaplätze, in München sind es auch Tausende. In Bielefeld sind Eltern verzweifelt, weil Betreuungszeiten reduziert wurden wegen fehlender Fachkräfte. In anderen Städten sieht es ähnlich aus. In 50 Jahren Praxis habe ich eine so schwierige Situation noch nicht erlebt.
Was heißt das für Beschäftigte, Kinder und Eltern?
Den Mitarbeitenden geht es damit sehr schlecht. Ich beobachte viele Krankmeldungen, Burn-out, Beschäftigte, die ganz aussteigen. Die Eltern, die in ihren Jobs ja auch unter Druck stehen, erleben keine Verlässlichkeit mehr in der Kinderbetreuung. Die Kinder werden in diesem Spannungsfeld aufgerieben – zwischen der Krise in den Einrichtungen und dem Druck, der auf den Eltern lastet.
Sie schreiben im Titel Ihrer Streitschrift vom Kita-Kollaps. Haben wir ihn schon?
Ja, wir haben den Kollaps schon. Und was die Gründe angeht: Ich glaube, wir sind den Kindern gegenüber gleichgültig geworden. Wir verwalten Kinder nur noch, wir lieben sie nicht mehr. Verwaltung und Politik müssten wir die Liebe zu Kindern intravenös spritzen. Am meisten ärgert mich die Langsamkeit beim Kita-Ausbau, wir kommen mit Entscheidungen nicht von der Stelle. Es hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert, was die Baugenehmigungen betrifft. Und ich merke: Es ist gar kein Leidensdruck da. Aber wenn wir uns nicht bewegen mit Genehmigungen, haben viele Kinder keine Chance auf Bildung.
Haben Sie Beispiele?
Da gibt es eine Verordnungsverliebtheit. Manchmal scheitern Bewilligungen an wenigen Quadratmetern, die in den Gruppenräumen fehlen. Wir sind verliebt in Sicherheitsauflagen, die festlegen, ob alle Steckdosen den richtigen Abstand haben oder ob die Garderoben breit genug oder die Toilettenwände hoch genug sind. Das Wohl des Kindes ist aber nirgendwo mehr gefährdet, als wenn wir sie ohne einen Betreuungsplatz lassen.
Aber selbst wenn es genügend Räume geben würde: Die Fachkräfte, die am Ende für einen schnelleren Kita-Ausbau nötig sind, kann sich ja niemand backen.
Das stimmt, aber trotzdem lässt sich vieles machen. Kontraproduktiv sind da jedenfalls Pläne wie im Bremer Koalitionsvertrag, die Zahl der betreuten Kinder in einer Gruppe auszuweiten und mit weniger ausgebildetem Personal zu arbeiten. Was ist das für ein Signal? Das drückt doch keine Wertschätzung aus. Wir brauchen multiprofessionelle Teams, auch gute Handwerker, die für Werkstattprojekte in Einrichtungen eingesetzt werden können. Natürlich geht es auch darum, die Ausbildung weiter auszubauen. Berufsbegleitend kann man dann mit den Leuten gleich in den Kitas starten. Auch Studierende in den letzten Semestern ihres Studiums und Menschen, die aus Ländern wie Brasilien, Spanien oder der Ukraine kommen und deren Abschlüsse wir zügig anerkennen, können die Kita-Teams verstärken. Außerdem: Wir haben in Deutschland 90 Studiengänge zur Frühpädagogik. Aber die Absolventen dürfen zum Teil nicht in den Einrichtungen arbeiten, müssen sich nachqualifizieren. Das ist einfach alles viel zu bürokratisch, das hat doch nichts mit gesundem Menschenverstand zu tun. Das sind Beispiele, die meine Hauptbotschaft unterstützen: Wir nehmen Kinder nicht wirklich ernst und wichtig.
Welche Stellschrauben sehen Sie noch, um die Situation zu verbessern?
Wir brauchen einen nationalen Bildungsgipfel, ganz kurzfristig, in diesem Herbst. Dazu muss der Bundeskanzler einladen. Mit Energiegipfeln kriegen wir das ja auch hin. Die gleiche Summe, die wir jetzt für Rüstung ausgeben, brauchen wir auch für die Bildung. Und den Drive, den Deutschland beim Ausbau der LNG-Infrastruktur hingelegt hat, den wünsche ich mir für die gesamte Bildung, nicht nur für die frühe Bildung. Da sind Sachverstand und Leidenschaft gefordert. Zentral ist für die Kitas vor allem mehr Flexibilität und Schnelligkeit in der Bereitstellung von Räumen. Wenn ich durch die Städte gehe und sehe, wie viele freie Räume wir haben, überall: Da könnten wir morgen anfangen, mit Kindern zu arbeiten. Alles ist besser, als die Kinder unversorgt auf der Straße stehenzulassen. Wir brauchen kurze Wege und schnelle Entscheidungen in den Baubehörden und auch ressortübergreifend.
Um den Kita-Alltag für Beschäftigte und Kinder zu verbessern, was ist außerdem nötig?
Das können wir nicht in Gruppen mit 23 Kindern machen. Dafür brauchen wir kleinere Gruppen. Bei Krippen sollten es nicht mehr als acht Kinder sein, bei den älteren 15, maximal 18. Das würde ja auch gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern. Dann haben wir auch nicht mehr so eine Abwanderungswelle. Mein Appell: Es geht um mehr Achtung und Wertschätzung – den Kindern gegenüber, aber auch den Beschäftigten gegenüber. Ich bin überzeugt, wir würden das hinkriegen. Wenn wir wollen.
Gibt es denn jetzt schon eine Kita, die Ihren Vorstellungen entspricht?
Die gibt es, an mehreren Stellen in Deutschland. Zu meinen Traum-Kitas gehört die kommunale Einrichtung Heide-Süd in Halle/Saale, die in diesem Jahr unter anderem für ihr offenes Konzept den Deutschen Kita-Preis bekommen hat. Kinder und Eltern können dort den Alltag mitgestalten, ihre Wünsche stehen über geplanten Abläufen. Es gibt Handwerkstage, Projektwochen und mehrtägige Ausflüge, einfach viele Gelegenheiten für neue Abenteuer. Da ist jeder Tag spannend. Wer jetzt denkt, dass es dort keine Regeln gibt, irrt sich. Das alles funktioniert nur mit einer Struktur. Einer Struktur, die Freiräume eröffnet.
Interview: Dieter Sell, epd
Zur Person
Ilse Wehrmann, 73, ist Diplom- Sozialpädagogin. Sie gilt als eine der wichtigsten Expertinnen der frühkindlichen Bildung und hat viel Erfahrung im deutschen Kita-System. Im Freiburger Herder-Verlag hat sie eine Streitschrift vorgelegt unter dem Titel „Der Kita-Kollaps – Warum Deutschland endlich auf frühe Bildung setzen muss!“. epd/Bild: epd
Vgl.dazu auch: https://www.blaetter.de/ausgabe/2023/august/kita-krise-kollaps