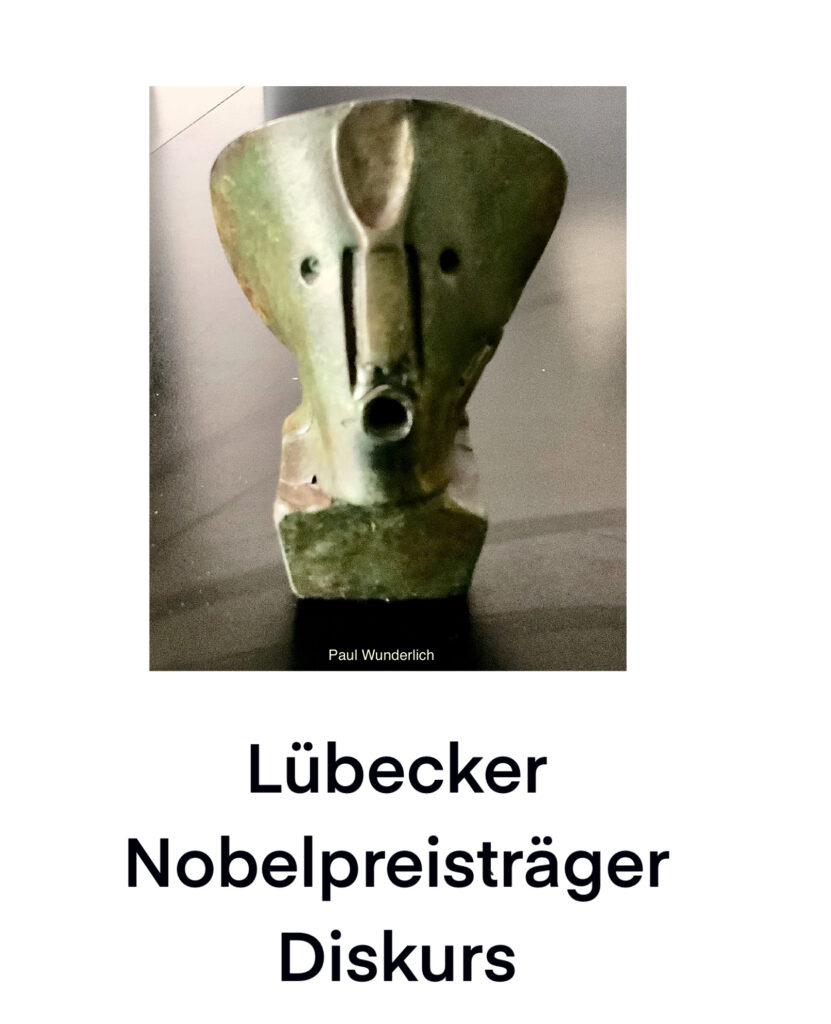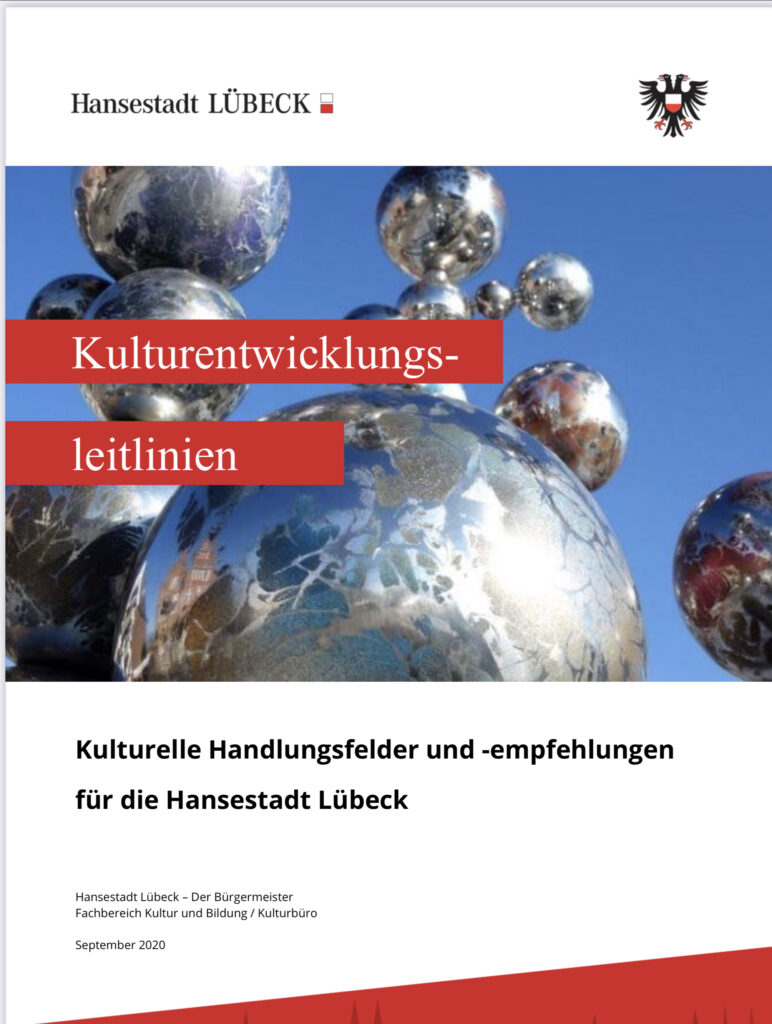Mit den Bürgerschaftsbeschlüssen vom 20.3.2023 und vom 27.6.2023 und dem Beschluss des Hauptausschusses vom 10.8.2023 zum Buddenbrookhaus findet die kulturelle Identität der Stadt nach dem 2.Mai 1945 ein Ende.
Lübeck gründete nach der Katastrophe des Bürgerlichen Zeitalters des 19.und 20. Jahrhunderts mit seinen weltweit rund 187 Millionen Toten (Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, München Wien 1995, S.26) seine geistige Identität maßgeblich auf die Botschaft von Persönlichkeiten wie Hans Blumenberg, Willy Brandt, Arnold Brecht, Edmund Fülscher, Erich Klann, Erika Klann, Minna Klann, Hermann Lange, Julius Leber, Heinrich und Thomas Mann, Erich Mühsam, Eduard Müller, Werner Puchmüller, Johannes Prassek, Gustav Radbruch, Karl Friedrich Stellbrink, Fritz Solmitz.
Das Museumsprojekt Buddenbrookhaus, das die Bürgerschaft 2022 mehrheitlich beschlossen hatte, symbolisierte den zukunftsgerichteten Willen und das Bekenntnis der Stadt zum europäischen geistigen Neubeginn nach den vom Deutschen Reich und seiner Bürgergesellschaft verursachten Menschheitsverbrechen.
Dieses Bekenntnis zu einem Neubeginn war bisher über Partei-, Religions-, Klassen- und Vermögensgrenzen hinweg in Lübeck unstreitig. Kern des Denkens dieser Lübecker Widerständler und Widerständlerinnen war die von Hannah Arendt in ihrem 1951 erschienenen Buch „Die Ursprünge des Totalitarismus“ herausgearbeitete grundlegende Unterscheidung von wahr und falsch:
„Eine Mischung aus Leichtgläubigkeit und Zynismus ist in allen Rängen totalitärer Bewegungen verbreitet, und je höher der Rang, desto mehr wiegt der Zynismus die Leichtgläubigkeit auf“. Das heißt, bei denjenigen, die die Öffentlichkeit täuschen, ist der Zynismus stärker, bei denjenigen, die getäuscht werden, ist es die Leichtgläubigkeit, aber die beiden sind nicht so getrennt, wie es scheinen mag.
Die Unterscheidung zwischen glaubhaft und unglaubwürdig, wahr und falsch ist für Menschen, die empörende und widerlegbare Ideen als Eintrittskarte in eine Gemeinschaft oder eine Identität ansehen, nicht relevant. Ohne das Joch der Wahrhaftigkeit um den Hals können sie Überzeugungen wählen, die ihrem Weltbild schmeicheln oder ihre Aggression rechtfertigen. Ich betrachte dieses Abgleiten in die Fiktion manchmal als eine Art Amoklauf des Libertarismus – früher sagten wir: „Du hast ein Recht auf deine eigene Meinung, aber nicht auf deine eigenen Fakten.“
Wer die Bürgerschaftssitzungen vom 20.3. und 27.6.2023 und die Sitzung des Hauptausschusses vom 10.8.2023 verfolgt hat, bleibt sprachlos zurück. Die Folgen dieser dort offensichtlich gewordenen im falschen Mittelalter steckengebliebenen widerwärtigen und verlogenen Weltsicht der Bürgerschaftsmehrheit für die Identität der Stadt, deren Haushalt, die nationalen und internationalen Nutzer und Nutzerinnen und die Beschäftigten des Museumsprojektes sind heute absehbar: Es ist die Inkaufnahme der Zerstörung der kulturellen Identität des Gemeinwesens Lübeck der Nachkriegszeit.